Nun mag man „Watch The Throne“ kommerzielles Kalkül unterstellen. Man nehme zwei Top-Rapper, einer davon rein zufällig auch noch ein Top-Produzent, packe die beiden zusammen auf eine Platte und heraus kommt die eierlegende Wollmilchsau. Klar, stimmt ja auch irgendwo, und natürlich denken unsere amerikanischen Verbündeten solche strategischen Überlegungen stets mit. Dennoch interessiert den aufmerksamen Hörer ja nur eines dabei: Ist „Watch The Throne“ nun der moderne Klassiker, den die Konstellation durchaus erwarten lässt oder doch nur ein altersseniler Eitelkeitsbeweis zweier arrivierter Herren?
Wie es sich für bedeutende Anlässe geziemt, beginnt das Spektakel nmit „No Church In The Wild“ nicht besonders spektakulär, gar mit einem Paukenschlag. Sondern ausgerechnet mit der wunderschönen Stimme des Senkrechtstarters Frank Ocean (Odd Future). Keine schlechte Wahl, Oceans wehmütiges Organ gibt einen perfekten Zeremonienmeister ab. Der Beat rumpelt zackig, fast wie Marschmusik, als Hova seine ersten Zeilen rappt. Unwillkürlich steht der Hörer stramm und salutiert. Es kann also losgehen.
Der zweite Track heißt passenderweise dann auch „Lift Off“, womit klar ist, in welche Richtung es gehen soll: Nach oben. Ein wahrer Stab von Produzenten wurde einberufen, um am Beat mitzuwirken, darunter Mike Dean von Rap-A-Lot, Q-Tip und Pharrell. Nur angemessen, denn mit Beyoncé erwartet man königlichen Besuch. Vor lauter Bewunderung für die stimmlichen Fähigkeiten von Jay-Zs Göttergattin, die es textlich zu den Sternen zieht („We gonna take it to the moon, take it to the stars/ How many people you know can take it this far?“), vergessen die beiden beinahe, selbst zu rappen. Das wird dann dafür auf „Niggas in Paris“ nachgeholt, das auf gesungene Lines verzichtet und voll aufs gesprochene bzw. gerappte Wort setzt. „Balls so hard mothafuckas wanna fine me“, protzt Jay-Z und Yeezy steht dem in nichts nach: „What’s Gucci my nigga? What’s Louie my killa? What’s drugs my deala? What’s that jacket, Margiela?“. Dazwischen ein vielsagendes Zitat aus dem Film „Blaze of Glory“: „No one knows what it means. But it’s provocative.“, darunter ein treibender, eingängiger Beat, Marke: Timbaland, als er es noch draufhatte.
Die Single „Otis“ dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Allein, wie Kanye, der hier ausnahmsweise mal alleine verantwortlich zeichnet, das Otis-Redding-Sample für die Strophen zerhackt und zerstückelt hat, ohne dass dabei ein Funken Soul verloren gehen würde, ist ganz großes Minigolf. „Gotta Have It“ und „New Day“ nehmen ein bisschen Tempo raus und bereiten den Hörer auf den nächsten Streich vor.
Der da heißt „That’s My Bitch“ und ein ziemlich dreister Schlag in die Fresse ist. Q-Tip flippt den „Apache“-Break und haut lediglich einen ganz gemein furzenden Bass darunter, der nach Sega Mega Drive klingt. Dazu zeigen Ye und Hov, was in ihren Augen eine gelungene Anmache darstellt. Während ersterer es mit arroganter Du-weißt-zwar-nicht-wie-man-Basquiat-schreibt-aber-egal-hier-ist-meine-Yacht-du-Schlampe-Attitüde probiert, packt Jigga den Kunst- und Modeexperten aus und droppt Referenzen an Designer, Maler, Museen und Kunstwerke. „That’s right nigga Mona Lisa can’t fade her/ I mean Marilyn Monroe, she’s quite nice/ But why all the pretty icons always all white?/ Put some colored girls in the MoMA“.
Nun erklingt der allseits bekannte Swizz-Beats-Sound, hektisch, nervös, aber durch lässige Synthie-Melodie-Sprengsel aufgelocktert und beinahe schon majestätisch. Zu Beginn befürchtet man noch, Alicia Keys‚ Ehemann würde gleich selbst anfangen zu rappen, aber gottlob belässt er es dabei, im Intro alle im Dschungel willkommen zu heißen, bevor Jay und Ye es souverän killen.
„Who Gon Stop Me“ fährt einen Dubstep’esken Bass auf, der dem Song Hymnencharakter verleiht und stellt einmal mehr die rhetorische Frage, wer die beiden eigentlich aufhalten will? Höchstens ein Geschichtsprofessor, denn die historisch reichlich schiefe Kanye-Ansage „This is something like the holocaust/ Millions of our people lost“ zeugt mal wieder vom undifferenzierten historischen Verständnis unser amerikanischen Freunde. Sei’s drum, starker Song.
Mit „Murder to Excellence“ wird dann so langsam schon die Schlussrunde eingeläutet – und es wird ein wenig ernsthafter, was den Inhalt angeht. Betont soulig kommt der erste von zwei Songteilen, den erneut Swizzy produziert hat, daher, um dann von einem recht klassischen BoomBapper abgelöst zu werden. Textlich wird recht präszise die prekäre Situation der afroamerikanischen Community umrissen, im nachfolgenden „Made It In America“, dem der gute Frank Ocean ein weiteres Mal seinen Stempel aufdrücken darf, dann, quasi als Gegenstück oder Trotzreaktion, die Erfolge afroamerikanischer Künstler, aber auch Politiker und Aktivisten gefeiert. Glaubwürdig ist das vor dem Hintergrund der beiden Protagonisten allemal.
Und zum guten Schluss gibt es dann nochmal Dubstep oder Post-Dubstep, dieses Mal garniert mit Mr. Hudson, dessen melancholischer Chorus für echte Abschiedstimmung sorgt. Allerdings auch dies nur ein Abschied auf Raten, denn dem interessierten Hörer stehen noch sage und schreibe vier Bonunstracks der iTunes-Version zur Verfügung, von denen die erste Single „H-A-M“ und das mit Curtis Mayfield-Sample ausgestattete „The Joy“ (prod. von Pete Rock) am meisten zu überzeugen wissen.
Dann fällt der Vorhang endgültig und was bleibt, ist die eingangs gestellte Frage nach dem Klassikerstatus. Ja, unbedingt, ein Klassiker. Durchkomponiert, mit gut nachvollziehbarem Spannungsbogen, Gänsehautmomenten, lyrischen Glanzpunkten und der richtigen Balance zwischen Vielfalt und Stringenz. Und doch kommt auch „Watch The Throne“ nicht umhin, ein Kind seiner Zeit zu sein. Während Klassiker früher als originäre Blaupause für jede Menge nachfolgende Künstler und deren Alben herhielten, bezieht dieser hier seine Genialität vielmehr aus den zahlreichen, gut ausgewählten Zitaten, ohne etwas genuin Neues hinzuzufügen.

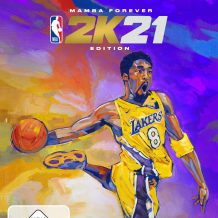



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






