Pressetext zu „…und dann kam Crack“ von Kingpint: „Der aus einem sozialen Brennpunkt in Köln-Porz stammende Rapper reflektiert mit seinen Lyrics seit über 10 Jahren die Strasse abseits üblicher Klischees und Standards.“ Das kann ich so leider nicht unterschreiben. Es ist mein erster Kontakt mit der Musik von Kingpint, so dass ich nicht weiß, was er vor 10 Jahren gemacht hat, aber was er heute veröffentlicht, ist inhaltlich wie musikalisch eben nicht abseits üblicher Klischees zu finden. Nun ist es für mich natürlich schwierig den Authenzitätsgrad der Drogengeschichten und des Straßenlebens zu überprüfen, aber ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, dass da was Wahres dran ist. Denn wenn Kingpint vor 10 Jahren schon über das Verkaufen von Drogen gerappt und sich durch Gunshots die Beats veredeln lassen hat, dann ist er der Vorreiter und darf das alles machen, so wie er es macht. Falls nicht, dann möchte ich auf einem deutschen GangstaRap-Album durch irgendetwas Einzigartiges, durch etwas Besonderes, von diesen beiden Klischees und Standards abgelenkt und von der Veröffentlichung überzeugt werden. Denn fernab von jeder Authenzität ist auch ein GangstaRap-Album immer noch Musik und sollte einen gewissen Anspruch vertreten.
Kommen wir zur also zur musikalischen Seite. Durchgängig von Brenna produziert, hat die Platte einen homogenen melodiös-harten Sound und weist als Straßenrap-Soundtrack keinerlei Schwächen auf. Wirklich stark ist das aus dem Rahmen fallende ruhige und stimmungsvolle „Manchmal“, dass Brenna & Desasta featured. Die vielen weiteren Features bieten ein große Abwechslung. Die von Tru-Mac und Butch Spencer werden sogar in englischer Sprache und das von Killa Hakan auf Türkisch vorgetragen, was die Sache noch weiter auflockert. Stimmlich ist mir der Protagonist Kingpint auf allen Songs aber leider zu schwach. Viele Aussagen könnten mehr Druck vertragen. Doch ist es wiederum gerade diese teils fast schon demütige Zurückhaltung, die an einigen Stellen aufhorchen und zuhören lässt, da sie auf andere Art und Weise intensiv ist.
Die erwähnten und weiter kultivierten, inhaltlichen Stereotypismen kann Kingpint durch seine Persönlichkeit insgesamt aber leider nicht vergessen machen, aber er kann ihnen immerhin einen eigenen Anstrich geben. Es ist schade, das jemand, der wirklich authentisch von der Gosse erzählen könnte, doch wieder in Klischees und Standards verfällt, anstatt die wirklich kreative Auseinandersetzung zu suchen. Wie lässt sich sonst ein Song wie „Bitch Mama“ am Ende des Albums erklären, der zum einemillionenundeinsten Mal eine Frau aufgrund ihres Verhaltens zu einer Schlampe erklärt. Schade, da wäre wirklich mehr drin gewesen, denn das Potenzial der Persönlichkeit Kingpints weiß schon hier den Hörer in seinen Bann zu ziehen. Nur die Umsetzung lässt noch zu wünschen übrig.

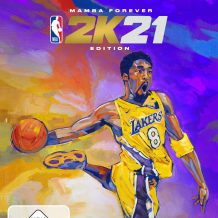



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






