Posen mit Schweinemaske lockt zwar heute keinen mehr hinter dem Ofen hervor, aber diese Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten, hinter denen man den großen Sinn vermutet, der massige Körper mit den Hosenträgern, die eher an einen Oi!-Skin als an einen klassischen Rapper erinnern und das nie ganz erkennbare Gesicht sorgen für so ein komisches Unwohlsein.
Dieser Gesamteindruck vom großen Unbehagen wird dann auf dem Album noch verstärkt, denn auf 17 Tracks wird eben nicht viel mehr als dieses große Unbehagen heraufbeschworen. Der gute Herr Degenhardt scheint einer der wenigen Rapper zu sein, dessen Soziopathentum keine Attitüde ist und dessen Nerd-Dasein sich nicht auf limitierte Sneaker und Designer-Toys beschränkt.
Schon im Intro muss man anerkennen, dass Degenhardts Filmgeschmack etwas über „Hey, hast du schon den neuen Tarantino gesehen?“ hinausgeht.
Auf „Soll das heissen“ werden Assoziationsketten gerasselt und allerhand komische Bilder gezeichnet, die im krassen Gegensatz zu dem massigen Körper mit der Schweinemaske und den Tätowierungen stehen.
„Disco Degen, Samstagabend, Toffifee und Internet“ genauso, wenn er sich als „deutscher Liedermacher auf den Spuren von Hans Hartz“ bezeichnet. Etwas konkreter wird er dann auf einem Track wie „Egonazi“ wo unter allerhand perfekt ausgewählten Film-Samples dass eigene Bedürfnis nach Fame und Anerkennung aufgezeigt wird: „Mein Schicksal wär’ ein kleiner Mann, mit Brille und mit Glatze“ gibt er zu, aber mit Händen und Füßen wehrt er sich gegen den Durchschnitt: „Rumgammeln ist Hippie-Scheiße, reißt euch mal zusammen, ich brauch nen Plan in meinem Kopf um meinen Körper zu entspannen (…) Ich will und kann noch soviel mehr, ich kann’s noch nicht so rüberbringen, doch habe doppelt soviel Wut wie die Gebrüder Grimm“.
Trotzdem wird das Album nie wirklich zum Seelenstriptease, die Welt, die Degenhardt zeichnet, bleibt irgendwie kühl und distanziert, was aber den Reiz des Albums noch steigert. Ab und zu bekommt der Mann mit dem Faible für deutsche Liedermacher aber doch ein bisschen Profil, zum Beispiel, wenn auf „Billy Idol“ der eigenen Kultursammelwut ein Denkmal gesetzt wird: „Ich kann nicht gut mit Menschen und ich scheiß drauf, was grad abgeht, ich wollte mich nur definieren, über das, was in meim’ Regal steht, ich kann mir mein Geld sehr gut einteilen, eins für Essen, zwei für Kleidung, 97 Prozent für Musik, Film, Bücher und ’ne Zeitung!“
Dass das Gucken von DVD-Specials und Alleine-ins-Kino-gehen einen nicht gerade zum sozialen Aufsteiger machen, ist Degenhardt klar, doch: „Ich bin so leicht zu begeistern und dass soll auch so bleiben“ und am Ende des Liedes wird eine Sammlung der Lieblingskünstler aufgezählt, die eben auch über „Ja, ich höre auch andere Sachen als Rap. Funk und Soul zum Beispiel!“ übersteigen: Von den Oi!-Punkern wie Oxymoron über den Stuckrad-Barre-Homie Christian Kracht, bis hin zu Ma$e und DMX, dazwischen noch Tocotronic, all das scheint das Weltbild von DDD zusammengezimmert zu haben.
Interessant wird es auch bei der Verbeugung vor der eigenen Drogenvergangenheit auf „Betty F. und Christiane Ford“, wo Degenhardt fast entschuldigend darauf hinweist, mit den Exzessen doch nur aufgehört zu haben, weil er jetzt endlich glücklich sei.
Freunden von klassischem Seelenexhibitionisten wird das alles vielleicht nicht so zusagen, genauso wenig technikbegeisterten Rap-Fans, die jedes Reimpattern aufdröseln und erst bei Quadrotime-Raps so richtig in Verzückung geraten. Besonders technisch anspruchsvoll ist das alles nicht, teilweise ist man sich nicht ganz sicher, ob es sich bei manchen Endungen um Zweckreime oder um die wirklich gewollte Aussage handelt und auch der etwas schlichte Flows werden dem Savas-Fan von Welt nicht besonders zusagen.
Für Leute, die dicke, tätowierte Männer mit Schweinemasken und Hawaii-Hemden mögen, ist das aber cool. Man darf gespannt sein, ob der Mann mit der Franz Josef-Hommage im Namen seinem Egonazismus nachgibt oder weiter Platten nach Style und Cover sortiert.
Ersteres wäre für Rap auf jeden Fall erfreulicher.

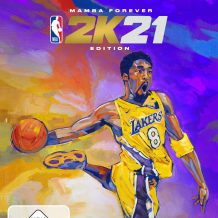



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






