Das ist beileibe nicht alles schlecht. Das ist solide. Da weiß man, was man bekommt, aber warten wir nicht alle, auf das Große, das Unerwartete, das Überraschende?
Dabei waren die Voraussetzungen doch perfekt. Der King kommt nach hause. Nach einem Jahr in Haft, das seiner Popularität in keinster Weise Abbruch getan hat. Das Rockexperiment ist mit dem sehr belanglosen Rebirth auch abgehakt worden, und nach drei Jahren Pause seit Tha Carter III, wäre somit der Weg frei für Lil Wayne der Rapwelt, dem Game, der Industrie und der Konkurrenz zu zeigen, wo der Hammer hängt. Nicht zuletzt ist Weezy aufgrund einer staatlich verordneten Abstinenz zum ersten mal in seinem Leben drogenfrei und vielleicht völlig klar im Kopf. Da müsste doch eigentlich ein Innovationsschub drin sein. Da hätte man doch so viel draus machen können. Da wäre doch was drin gewesen. Da müsste doch was gehen. Tja. Ist es aber anscheinend nicht.
Zwar rappt sich D. Carter mit einiger Begeisterung durch seine 15 Tracks und das ist in der Regel wirklich auch durchweg sehr anhörbar, aber wohlwollend gesprochen überlässt er die wirklichen Glanzparaden seinen Featuregästen wie Cory Gunz, Drake, einem glänzend aufgelegten Tech9 oder sogar seinem dicken Kumpel Ricky Rauss. Noch wohlwollender gesprochen könnte man auch sagen: Er lässt seine Gäste scheinen und hält sich gentlemanmäßig zurück. Gehässig gesprochen lautet die Frage dann allerdings eher: Will er oder kann er nicht besser? Oder noch gehässiger: Kann Herr Wayne tatsächlich nur diesen einen Flow? Und lebt sein Rap wirklich nur vom Druck der Emotionen, die er in seine Zeilen packt?
Das trägt zwar ziemlich weit und Angebergeschichten, wie fett sein Label ist, gemischt mit echter Verzweiflung, Enttäuschung über falsche Freunde und Frauen, die ihn während seiner Knast-Zeit hinter seinem Rücken verraten haben sollen sowie einer ausgeprägten Todessehnsucht ergeben auch durchaus stimmungsvolle Momente auf Tha Carter IV – aber so echte Highlights?
„6 Foot 7 Foot“ ist vielleicht eines, aber eigentlich eher wegen dem Cory Gunz Part und dem Harry Belafonte Klassiker „Day O“, der da als Sample im Hintergrund dudelt.
„John“ ist auf jeden Fall ein Höhepunkt, aber eigentlich auch eher wegen des Rick Ross Parts, der zumindest mich ein wenig überrascht hat, indem er den Andy Warhol Zögling und früh verstorbenen Maler Jean Michel Basquiat in einem Reim erwähnt, nur um ihn gleich darauf wieder mit einem roten Lamborghini zu verwursten. – Assoziatives Reimen. Manchmal steigt man da wirklich nicht durch: „The bigger the bullet, the mo‘ that bitch gon‘ bang!/ Red on the wall, Basquiat when I paint/ Red Lamborghini ‚til I gave it to my bitch/ My first home invasion, pocket gave me forty bricks.“
Tatsächlich gibt es jede menge gute Stücke auf der Platte, allen voran „Blunt Blowin“ mit seiner einprägsamen Hook, aber das war’s dann irgendwie auch mit den Lil Wayne Solo-Tracks.
„It’s good“ ist mit Sicherheit ein echtes Rap-Brett, wobei Jadakiss dem Angry-Wayne mit seinem aggressiven Part eine exzellente Steilvorlage liefert.
Auch das Outro muss man erwähnen. Mit dem „Outro“ kommt nämlich endlich wieder einmal echter Südstaatenflavour auf und somit auch echte Freude. Ein nervöser Beat mit diesen schönen hektische High Hats und einem wirklich extraordinären NAS-Part, neben den ebenfalls sehr guten Bun B, Shyne und Busta Rhymes ABER ohne Lil Wayne!!!!! Das ist ein echter Kracher, ABER, und das sollte zu denken geben, ABER eben ohne Lil Wayne.
Das Gefühl der Mut- und Kreativlosigkeit ergibt sich wahrscheinlich weitestgehendst aus der konventionellen Instrumentierung des Albums. Was Mr. Bangledesh, Megaman und wie sie alle heißen hier produziert haben, ist halt eben überhaupt nicht neu und spannend und anders und Wahnsinn und verrückt sondern irgendwie alles ganz solide, nach vorwärts marschierende, abgehende Beats – nicht mehr und nicht weniger.
Mit „How To Love“ gibt es einen gitarrelastigen, singersongwriter-attitude-mäßigen kleinen, ganz kleinen musikalischen Ausbruchsversuch, aber das alles ist viel zu harm- und mutlos, zu konventionell, zu zaghaft um wirklich ins Gewicht zu fallen. Dabei hätte man da doch so viel rausholen können. Müssen, sollen, dürfen.
Insgesamt wird man schon satt von „Tha Carter IV“ und die Qualität des Essens ist durchaus korrekt, aber so eine echte Südstaatenküche mit Okras, Gumbo, Süßkartoffeln, Eintöpfen aus Schweinefüßen, Jambalaya und anderen kulinarischen Wahnsinnigkeiten ist das Album eben auch nicht. Eher so Kentucky Fried Chicken. Da kann man auf der ganzen Welt hingehen und weiß immer, was man bekommt. Das ist gut, aber besonders ist es nicht.
Und eins noch zum Schluss: „How To Hate“ mit T-Pain ist wirklich schrott. Zumindest den sollte Herr Carter auf dem nächsten Album als Featuregast einfach mal weglassen. Reicht ja jetzt auch.


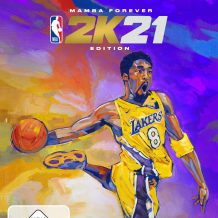



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






