Seit etwa zwei Jahren bombardiert Lil B nun das Internet auf allen Kanälen mit seiner Musik über YouTube, Facebook und Twitter. Noch vor dem vorläufigen Tod von MySpace legte er sich dort an die 200 Profile an und lud auf jedes fünf Songs hoch. Das eigentlich Verrückte daran: Es funktionierte prächtig. Lil B wurde berühmt, er bekam Props von allen Seiten (Soulja Boy, Diddy, Kanye West), seine Konzerte waren (und sind) ausverkauft. Der amerikanische Traum wurde wieder einmal wahr, was dann auch ein eklatanter Unterschied zur Karriere von Moneyboy ist.
Dabei hat sich sein musikalischer Output in letzter Zeit sehr verändert. Machte er am Anfang mit ultraprimitiven Dirty-South-Beats, völlig überdrehten Gangsta-Phantasien und absurden Phrasen á la „Bitches on my dick coz I look like their father“ auf sich aufmerksam, so hat er spätestens mit seinem ersten offiziellen Album „Angels Exodus“ ganz andere Töne angeschlagen. Seitdem gibt er den Motivator, den nachdenklichen, aber grundsätzlich extrem positiv eingestellten Vordenker, der zu Friedfertigkeit, Zufriedenheit und Optimismus aufruft. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach einer Sparversion des unsäglichen Dalai Lhamas oder dem Rapcousin des noch unsäglicheren Sri Sri Ravi Shankar – doch weit gefehlt. Lil Bs Spiritualität ist extrem glaubwürdig und seine Lyrics sind weit intelligenter als die oberflächlichen Politverse von Nas, dead prez und Paris zusammen.
Nun also das große Album „I’m Gay„. Natürlich ist der Titel, der sowohl „Ich bin fröhlich“ wie „Ich bin schwul“ heißen kann, eine gezielte Provokation. Lil B hat die engen Gendergrenzen, in denen HipHop immer noch verhaftet ist, auch vorher schon gerne aufgebrochen, indem er sich als „pretty bitch“ oder „fag“ (deutsch: Schwuchtel) bezeichnet hat. Auch dieses Mal ließ die Empörung nicht lange auf sich warten – ganz, wie Lil B. es wohl geplant hatte. Wunderbar!
Einen Sonderpreis hat sich Lil B auch für seine Unbekümmertheit in Sachen Marketing verdient. Große Ankündigungen? Countdown bis zum Release? Ach was, wozu denn? „Ihr könnt euch das Album ab heute bei iTunes runterladen“ twitterte er am 29. Juni einfach so wie nebenbei. Ist halt ein echter Internetjunkie, der 24/7 an seinem Laptop hängt und alles Wichtige stets in Echtzeit twittert, darunter eben auch Releaseankündigungen. Sehr konsequent.
Die Musik auf „I’m Gay“ ist angesichts dieses ganzen Spektakels und Drumherums eigentlich fast nebensächlich. Es soll aber dennoch erwähnt werden, dass sie sehr gut ist, besser als alles, was Lil B zuvor gemacht hat. Von den simpel gestrickten Dirty-South-Bangern hat er sich mitterweile weitgehend verabschiedet, die spart er sich für seine Mixtapes auf. Stattdessen wird die getragene Vortragsweise von melodiösen, eher der klassischen New Yorker Ästhetik verpflichteten Beats begleitet. Der Opener „Trapped in Prison“ handelt natürlich nicht von Gefängnisaufenthalten (Lil B saß tatsächlich mal im Jugendknast, bevor er „based“ wurde), sondern vom, naja, Christoph Daum würde es „Gedankengefängnis“ nennen. Lil B hat wirklich seine ganz eigene Sprache gefunden: „Mental slavery /Niggas be hanging off of trees in the woods, like the hood/ It’s more than Martin Luther King, fighting for a dream/ Watch me go against everything you believe„.
Auf „I Hate Myself“ wagt er sich sogar an das diffizile Thema schwarzer Selbsthass heran, in unspektakulären, aber eindringlichen Worten: „I see myself in the mirror, but I don’t see nothing/ If you understand what I’m seeing please tell me something/ When you black, the media make you wonder why/ I just need my history, because I hate myself„.
Zwar erschließt sich die Lil B’sche Dialektik dem Hörer nicht immer ganz, wenn er etwa auf „Gon Be OK“ erklärt: „This song is depressing/ but it’s uplifiting„, aber: Große Kunst versteht man eben nicht immer sofort auf Anhieb und das ist an dieser Stelle ausnahmsweise nicht mal besonders ironisch gemeint.
Lil B ist ein Gesamtkunstwerk, soviel steht fest. Sein neues Album „I’m Gay“ ist ein weiterer Ast an diesem Baum, der immer noch wächst und wächst und dabei soviel Positives und Lebensbejahendes aussendet, dass sich jedes Odd Future-Member noch vor dem Ableben in seinem Grab umdrehen würde: „Karma is real, and you gotta love it/ I could take a few trips in advance/ Look! I’m flying to the snow and/ I visit the sand„.
Ich besuche den Sand – darüber sollte man bei Gelegenheit mal nachdenken, wenn man gerade viel Zeit hat. Oder einfach nochmal „I’m Gay“ hören.

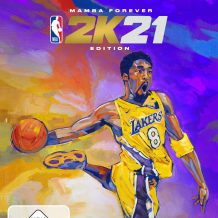



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






