Sein nun endlich vorliegendes viertes Werk, das „R.E.D. Album„, das man schon beinahe versucht war, in die Schublade „Sankt Nimmerleinstag“ zu legen, wo auch „Detox“ selig schlummert, ist leider auch nicht der große Befreiungsschlag geworden, den man erhofft und dem sympathischen, ungestümen Jungen auch von Herzen gegönnt hätte. Dabei waren die Voraussetzungen nicht die allerschlechtesten: Niemand anderes als Pharrell Williams spielt den ausführenden Produzenten und auch der gute, alte Dre lässt es sich nicht nehmen, Intro, Outro sowie zwei kurze Skits zu sprechen, die ein wenig Licht in die Irrungen und Wirrungen des Jayceon Terrell Taylor bringen sollen.
Statt nur herumzulabern hätte Dre indes lieber mal selbst Hand anlegen sollen und ein paar richtige Granaten produzieren sollen, denn daran, also an Granatenbeats, mangelt es dem roten Album allerdings. Während der Produktionsphase hatte Game noch verkündet, mit einer absolut wahnsinnig anmutenden Armada von Produzenten zu arbeiten, als da wären Jim Jonsin, No I.D., Swizz Beatz, will.i.am, Just Blaze, DJ Quik, Nottz, Hi-Tek, Maestro, Ryan Leslie, Don Cannon, Scott Storch, J.U.S.T.I.C.E. League und Lex Luger. Übrig geblieben sind von dieser irrsinnigen Liste lediglich Maestro und Don Cannon.
Und statt Dr. Dre dürfen Cool & Dre dreimal ran – nicht, dass die beiden ihre Sache schlecht machten, im Gegenteil, der Opener „The City“ gehört mit zum Besten, was von Game in den letzten sieben Jahren kam. Mit ordentlich Wut in der Stimme eröffnet er sein neues Album forsch und mit einer ungewohnten Tonlage, die gar nicht mehr so gewohnt lässig und überheblich daherkommt, sondern mit ihrer Verbissenheit fast schon eher an einer abgeschwächte Variante von DMX erinnert. Zur Hand geht ihm dabei der Senkrechtstarter Kendrick Lamar, der sich ebenfalls nicht lumpen lässt und vor allem gegen Ende alle Register seines lyrischen Könnens zieht. Ein starker Auftakt.
Das darauffolgende „Drug Test“ war schon vorab bekannt, kann daran aber leider nicht anknüpfen. DJ Khalil versucht sich als Aushilfs-Dre, was eigentlich noch nie gut gegangen ist. Auch in diesem Fall nicht. Gut, sagt man sich, ist ja erst der zweite Song, da ist ein bisschen Westcoast-Retro-Folklore mit den eher lethargisch agierenden Legenden Snoop und Dre am Mikrofon schon okay.
Der dritte Song, „Martians vs. Goblins„, ist dann wieder richtig stark, hat allerdings einen großen Schönheitsfehler: Er kommt überhaupt nicht wie ein Game-Song rüber. Die allesvernichtende zweite Strophe rappt nämlich der Odd Future-Vampir Tyler, the Creator mit seiner versoffen sägenden Mörderstimme dermaßen eindrücklich, dass der rote Rapper sich anscheinend davon mitreißen lassen und seinen Flow so dermaßen an Tylers Style angepasst hat, dass man fast glauben könnte, der ganze Song sei ein Odd Future-Song.
Und damit sind wir schon beim Hauptproblem von „The R.E.D. Album“ angelangt: Game kann oder will die Rolle des Hauptdarstellers einfach nicht ausfüllen. Stattdessen lässt er sich von seinen hochkarätigen Gästen desöfteren die Schau stehlen, etwa von Young Jeezy bei „Parademics„, was schon damit anfängt, dass Maestro dafür einen klassischen Südstaatenbanger hingehauen hat, auf dem Schreihals Jeezy weit weniger fremd wirkt als Game. Und auch Bauss Ricky alias Rick Ross fühlt sich auf dem StreetRunners-Beat von „Heavy Artillery“ hörbar wohler als der wackere Compton-Representer.
Natürlich gibt es auch richtig starke Momente auf „The R.E.D. Album„, der DJ Premier-Stampfer „Born In The Trap“ etwa oder das flotte „Speakers On Blast„, auf dem Game sich in Bestform präsentiert, weshalb ihm auch Big Boi und E40 nicht die Butter vom Brut nehmen können. Auch der letzte Song vor dem Outro, das gut sechsminütige „California Dream“ (produziert von Mars) trifft voll ins Schwarze und erzeugt einen dieser magischen Game-Momente. Game ist einfach immer noch am besten, wenn er die Geschichte der Westcoast in pathetischen Worten beschwört. Er ist der charismatischste Geschichtsprofessor, den Rap kennt. Fast erstaunt stellt man außerdem fest, dass der Song mit Nelly Furtado, „Mama Knows„, nicht in die Hose geht, ganz im Gegenteil, aber da haben die Neptunes schon durch den dezent melancholischen Beat vorgesorgt.
Leider stehen dem aber verwirrend uninspirierte Songs wie die wenig überzeugende Single „Red Nation“ oder die drei kaum von einander zu unterscheidenden Stücke „Hello„, „All The Way Gone“ und „Pot Of Golds“ gegenüber, deren banale Hooks jeweils Lloyd, Mario und Chris Brown trällern dürfen. Das erzeugt keine Spannung und schon gar keine Gänsehaut.
Was „The R.E.D. Album“ ironischerweise trotz der häufigen Verwendung des Begriffes „rot“ fehlt, ist ein roter Faden, eine stringente Geschichte, ein nachvollziehbarer Spannungsbogen. Eigentlich schade, dass so ein guter Rapper erneut so ein harm- und wahlloses Album abliefert, dass leider überhaupt keine Suchtgefahr entwickelt.


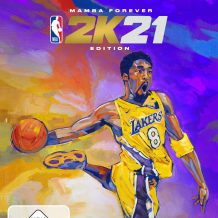



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






