Was macht man als Musiker, Multimillionär, CEO eines großen Plattenlabels und Chef einer Bekleidungsmarke, wenn man eigentlich schon alles erreicht hat? Klar, man macht noch ein Album, versucht sich als Künstler weiter zu entwickeln und neue Wege zu beschreiten. Der Begriff Konzeptalbum ist seit den Beatles ein goldenes Kalb, um das immer wieder eifrigst getanzt wird, nun ist einer der bekanntesten, profiliertesten und etabliertesten Rapper auf die Idee gekommen, das auch mal mit einem Hip Hop Album zu probieren. Den Rahmen dafür gibt die eben erst in die Kinos gekommene Gangster-Schmonzette „American Gangster“, die das Leben des in den 70ern in Harlem herrschenden Drogenbarons Frank Lucas beleuchtet, vor. Jigga sagt dazu, dass das Album seine eigene Version, seine musikalische Interpretation des Werkes sei. WIr werden im Folgenden untersuchen, wieviel Konzept in „American Gangster“ steckt.
Das Album beginnt auf jeden Fall cineastisch, mit einigen Zitaten aus dem Film und einer dramatisch gesprochenen Definition des Wortes Gangster zu ebenso dramatischer Musik. Die Verklärung, ja Bewunderung dieses „Gangstertums“ von Rappern oder der Hip Hop Bewegung allgemein ist schon Thema eines ausführlichen Beitrags in der aktuellen Juice (12/07) und soll hier nicht weiter ausgeführt werden. Denn es geht um die Musik. Nach dem Intro kommt „Pray“ und führt die Dramatik des Intros fort, der Beat geht sehr nach vorne (mit „four to the bar“ Kickdrum). Verzerrte Gitarren und ein melancholisches Ostinato treiben Hova an, der spittet sich hier schon mal warm, stellt sich als Gangsta vor und beschreibt die Härten dieses Lebens – nicht nötig zu erwähnen, dass die Glaubwürdigkeit dessen, auf Grund seiner oben genannten Positionen, erheblich leidet, aber darum geht es nicht, denn das hier ist allerfeinste Street Poetry, wie man sie von ihm gewöhnt ist.
Aus großen Teilen des Albums kann man eigentlich nur folgendes lernen: Dass ein Marvin Gaye-Sample etwas verdammt Schönes sein kann, wenn es allein in einem Intro steht und einen an die wahre Meisterschaft dieses Soul-Giganten erinnert, aber dass man eben auch Songs kaputt machen kann, indem man erstens zu viele Vocal Samples verwendet (wie bei „Party Life“) oder indem man dann noch zu viel eigenes Material – besonders wenn es sich um fette Streicher, die viel Platz einnehmen, handelt – hinzufügt und dadurch einen Song zu beliebig, zu wenig integriert klingen lassen kann („American Dreamin’“). Des weiteren braucht ein Track nicht zwingend eine Hook, was Hova bei „No Hook“ eindrucksvoll beweist, und außerdem sollte er niemals über einen schwachsinnigen, durch Melodienarmut bestechenden, unterirdischen Crunk-Beat rappen („Hello Brooklyn 2.0“) – das bringt ihn in Verruf und droht fast die ganze Platte in Frage zu stellen. Ich stelle außerdem fest, dass das Album immer dann interessant wird, wenn die 70er Jahre Samples-Schiene verlassen wird und ein origineller 80er-Neptunes-Beat erklingt („I Know“) oder Just Blaze Jigga Man zu wahren Höchstleistungen anstachelt („Ignorant Shit“ mit einem ausgeschlafenen Beanie Sigel). Fast schon schrullig, nerdy ist der Track, auf dem auch Nas zu hören ist („Success“), mit einer nervtötend schrillen Orgel und verzerrten Drums. Immerhin originell und irgendwie fast schon sublim. Das ist auch der zweite Beitrag der Neptunes, gleichzeitig die erste Single („Blue Magic“), typisch für das Produzenten-Duo und doch wieder neu; sehr sparsam treffen hier Sounds der beliebten 808-Drum Machine auf ruppige Synthies und übertrieben vordergründige Percussion, alles sehr im Einklang mit dem Flow des Meisters.
Ich will nicht übertrieben nostalgisch sein, aber wenn man nach diesem Album mal ältere Aufnahmen Jay-Zs zum Beispiel über einen Primo-Beat hört, weiß man, wo der Unterschied liegt. Dieses Gerüst scheint seine Raps um ein hundertfaches besser zu tragen. Auf „American Gangsta“ hingegen, das sich musikalisch viel zu sehr vom „neuen“ Gangsta-Pop-Style verführen lässt, ist diese Magie leider nur noch punktuell zu spüren. Unter dem Strich wird mir das Konzept, von dem die Rede ist, absolut nicht ersichtlich. Unter Konzept verstehe ich, wenn das Album von vorne bis hinten einen roten Faden, nicht nur thematisch oder textlich, sondern auch musikalisch, hat. Das ist schon auf Grund der Diversität der Producer nicht möglich, was aber auch ein Glück ist, denn wäre Hova nur bei dem Producer geblieben, der den Großteil des Albums musikalisch unter seinen Fittichen hatte, nämlich Diddy und sein Team LV & Sean C, wäre das wohl eine mittlere Katastrophe geworden. Deren Produktionen haben ganz klar ihre starken Momente, aber sie langweilen einfach doch ziemlich oft (und scheinbar auch sich selbst) durch das stetige Durchkauen dieser schon erwähnten 70er-Jahre Soul Samples – und manchmal scheint es, als würde einfach nur Zeit totgeschlagen (wieder: „Party Life“), und das ist schon fast eine Unverschämtheit. Einigies auf diesem Album ist zwar recht hörenswert, ein Meilenstein jedoch ist „American Gangster“ nicht – eher gepflegtes und dem Geist der heutigen Zeit angepasstes Mittelmaß.

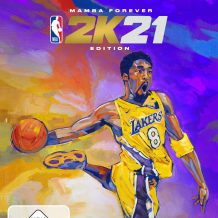



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






