
Sommer 1991, in einer heruntergekommenen Gegend von Compton. Ein Mann erklärt zwei Jungs die Tragweite eines Plakats, auf dem ein Unternehmen damit wirbt, Grundstücke in der Nachbarschaft zu günstigen Konditionen aufzukaufen: „I’m talkin’ about the message. What it stands for. It’s called gentrification.” Der Mann ist Furious, die Jungen sind Tre und Ricky aus dem Gangster-Klassiker „Boyz n the Hood“ . „It’s called gentrification“. In der deutschen Fassung wird daraus: „Das Ganze nennt man Edelsanierung.“ Klar, wer hätte Anfang der Neunziger auch etwas mit dem Begriff Gentrifizierung anfangen können? Mehr als zwanzig Jahre später ist das Wort wenn nicht in aller, so doch in vieler Munde.
Zumindest in deutschen Großstädten. Und längst wird die Verdrängung ganzer Bevölkerungsgruppen aus ihrer bisherigen Wohngegend infolge von „Aufwertung“ der Kieze auch im deutschen Rap thematisiert. Und das ist super, denn das Thema ist drängend. Oft werden dabei aber gleich die angeblich an der Misere Schuldigen mitgeliefert. Touristen. Yuppies. Schwaben. Zugezogene generell.
Schon 2011 rappte Prinz Pi in „Zu Hause“ von „westdeutschen Huren“ und abwertend davon, dass der Berliner Prenzlauer Berg „verschwabt“ sei. Matondo kommt in seinem sicher gut gemeinten Song „Hände weg“ doch tatsächlich mit einem astreinen „Ich hab nichts gegen, aber…“-Satz. Zugegeben, in diesem Fall richtet er sich nicht wie sonst oft gegen eh schon ausgegrenzte Gruppen. Hässlich bleibt er trotzdem. „Sie benehmen sich kaum, kotzen rum und sind frech“. So ist das also. Das erinnert auf unangenehme Weise an PTKs „Antiturista“, in dem Yuppies, Zugezogene und Touristen für die Gentrifzierung verantwortlich gemacht werden.
In staigeresker Manier könnte man hier von verkürzter Kapitalismuskritik reden. Und träfe damit trotzdem nicht das Problem. Denn in diesen Liedern wird doch recht wenig Systemkritik geübt. Hier werden einzelne Personengruppen – der Einfachheit halber zu Stereotypen verdichtet – für Prozesse verantwortlich gemacht, die sie zwar ermöglichen, jedoch höchst wahrscheinlich nicht beabsichtigen. Zugezogene erhöhen nicht deine Miete. Das machen die Vermieter_innen. Touris steigern nicht die Preise der Cafés in deiner Gegend. Das machen die Besitzer_innen, möglicherweise selbst mit steigenden Mieten konfrontiert. Es klingt ausgelutscht, aber trägt etwas Wahres in sich: Don’t hate the player, hate the game.
Und es ist nicht alles schwarzweiß – Menschen, die höhere Mieten bezahlen können und so (ungewollt) zur Verdrängung finanziell schwächerer Menschen beitragen, werden mitunter einige Jahre später wiederum von noch Reicheren verdrängt. Oder können sich teuere Viertel – laut PTK gehören sie an den Ku’damm, nicht aber nach Kreuzberg – gar nicht erst leisten. Wenn sich der Easy-Jetset in die ehemals unattraktiven Viertel der Städte ergießt, profitieren nicht selten Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Wenn das Bier teurer und der Döner kleiner wird, ist das irgendwie scheiße. Aber am Ende haben die Kioskbesitzerin und der Imbissbetreiber mehr von ihrem Knochenjob. Und mal ganz ehrlich – wie lebenswert wäre eine Stadt wie Berlin, ohne die zwei Drittel der Bevölkerung, die nicht in dieser Stadt geboren sind? Rap kam unter anderem durch amerikanische Soldaten in die Stadt und wurde von Kindern der so genannten Gastarbeiter kultiviert. Um nur zwei Beispiele zu nennen.
Um so erfrischender ist es, dass gerade jetzt derselbe PTK eine zweite Version seines Liedes rausgebracht hat, die mehr auf die Ursachen von Verdrängung eingeht und nicht nur deren Symptome beschreibt und daraus einfache Schlüsse zieht. Denn hier sind es nicht mehr Yuppies, Touris und Zugezogene, die als Schuldige identifiziert werden, sondern Grundeigentümer, Makler, Investoren, Spekulanten und der Senat. Das ist zwar keine fundiert-differenzierte Kapitalismuskritik, aber es handelt sich hier schließlich um einen Rapsong und nicht um ein politisches Essay.
Dass man sich diesem ernsten Thema auch mit Humor und ohne lyrische Mistgabeln und Fackeln nähern kann, zeigen die Jungs von Zugezogen Maskulin, die die Thematik ja bereits im Crewnamen tragen. Den Tourihass rücken sie provokant in die Nähe der Thesen eines Thilo Sarrazin. Im Jahre 2050 hält die sturmreif gefeierte türkisch-deutsche Gesellschaft dem Druck der spanischen Partyhorden nicht mehr stand und schafft sich ab. Dabei verlieren sie nicht den Blick für die Verhältnismäßigkeit, wenn grim104 trocken feststellt: „Spanier in Kreuzberg, die Rache für Mallorca“ .
Und es gäbe noch mehr Beispiele. Ist nun Rap politischer geworden? Oder politischer Rap fresher geworden? Vielleicht sind es nur die Themen wie eben die Verdrängung aus den Vierteln, die näher an den Leuten sind, weil sie sie selbst und/oder ihr Umfeld betreffen. An sich eine begrüßenswerte Entwicklung – aber bitte doch ohne wenig hilfreiche Pauschalverurteilungen.


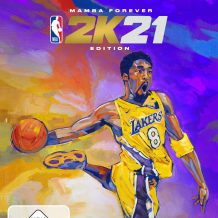



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






