Zwei der größten Player im US-Rap veröffentlichen fast zeitgleich neue Alben. Nach ihrem gemeinsamen Werk „Watch the Throne„, einem nahezu perfekten HipHop-Album mit fein abgeschmeckten Beats, ultrateuren Samples und dem richtigen Schuss Wahnsinn slash Genie widmen sich die beiden ausgesprochen erfolgreichen Herren wieder dem Tagesgeschäft, sprich ihren Solokarrieren.
Dabei werden sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede zwischen Kanye West und Jay-Z deutlich. Beide haben sich für ihre Soloalben wieder nicht lumpen lassen und keine Kosten und Mühen gescheut, um sich nur die besten Beats produzieren zu lassen. Nur die besten (oder bestbezahlten) Produzenten ließ man ihr Händchen an „Yeezus

Und so ballert Kanyes „Yeezus“ gleich in den ersten drei Songs von ohnehin nur zehn los wie ein von der Tarantel gestochener Ochse. „On sight„, „Black Skinhead“ und „I am a god“ wurden allesamt unter tatkräfitger Mithilfe von Daft Punk produziert. Und deren elektronischer Sachverstand ist eben meilenweit vom lahmen Dubstep bzw. seit neustem Trap-Aufguss deutscher Producer entfernt. Das hier erinnert eher an den guten alten Chicago-House als an Skrillex. Dagegen kommt „Magna Carta Holy Grail“ eher langsam in Fahrt. Zur Eröffnung gibt es die extrem kitschige „Holy Grail„-Schmonzette, die von Justin Timberlakes Gesang leider weitgehend ungenießbar wird. Erst danach geht es mit „Picasso Baby“ so richtig los – ein rumpeliger Beat, der eher nach J.Rocc als nach J-Roc und Timbo klingt (die beide an der Produktion beteiligt waren). Danach wird dann ein bisschen dem Trap-Zeitgeist gefrönt, „Tom Ford“ erinnert von der Bassline ein wenig an den „Whisper Song“ von den YingYang Twinz.
„Yeezus“ bleibt, auch wenn es gegen Ende etwas souliger und konventioneller wird, ein faszinierender schwarzer Monolith von einem Album. „Hold my liquor“ und „I’m in it“ widmen sich den beiden großen Versuchungen des Lebens, Sex und Alkohol. Mit „Blood on the leaves“ recyclet Ye dann einfach mal den im Nachhinein so stilprägenden Sound von „808s & Heartbreaks„, für den er damals so viel Kritik und Hass einstecken musste. Den würdevollen Abschluss bildet mit „Bound 2“ ein nahezu versöhnlicher Song, der auf einem genial gechopten Sample von Nina Simone basiert.
Jay-Z indes hat sich die Höhepunkte für den Mittelteil aufgespart und legt erst mit „Oceans„, „Heaven“ und „Beach is better“ so richtig los. Anders als Kanye, der von einem unbezwingbaren Furor getrieben zu sein scheint, ist seine Sozialkritik weitaus subtiler und dezenter zwischen den Zeilen versteckt. „I’m anti-Santa Maria / Only Christopher we acknowledge is Wallace“ gibt er sich in „Oceans“ als Indianerfreund zu erkennen. Das inhaltlich spannendste Stück ist aber „Heaven„, in dem Jay-Z ironischerweise gleichzeitig den Verschwörungstheoretikern widerspricht, die stumpf „Illuminati“ brüllen, wenn sie ein Dreieck oder einen erfolgreichen Afro-Amerikaner sehen, und mit „Question religion, question it all/ question existence until the question is solved“ echte Freimaurer-Maximen abseits von rechtsradikaler Paranoia widergibt: Alles hinterfragen, alles in Frage stellen, Erkenntnis durch Aufklärung – das sind im Gegensatz zu schlecht verdauter katholischer Propaganda tatsächlich die Forderungen der Logenbrüder.
Kanye indes ist an solchen Spielereien nicht interessiert. Im Gegensatz zum kühlen, rationalen Jay-Z, der seine Arroganz stets mit einem selbstsicheren Grinsen im Mundwinkel nach außen trägt, ist er triebhafter, getriebener, voller Wut und Rachegefühlen. Sein Duktus ist anklagend und polarisierend und wenn er angibt, dann nicht lässig-überheblich, sondern richtig übertrieben (STF-Voice). Sein spätpubertärer Sexsong „I’m in it“ mit lyrischen Glanzlichtern wie „Eating asian pussy all I need is sweet and sour sauce“ zeugt ebenfalls von diesem Unberechenbaren, Wildem, Atavistischem in ihm.
Dagegen ist Jay-Z ganz cooler Geschäftsmann, ganz rationaler Denker, mit einem gewissen Hang zur Selbstüberhöhung, klar, aber letztendlich doch immer auf dem Boden der Tatsachen. Und auf dem Boden des klassischen Rap-Sounds. Von der Experimentierfreudigkeit und dem Mut zur Innovation eines Kanye West, der nie zufrieden scheint, immer weiter nach vorne prescht und immer neue Grenzen einreißen will, ist Hov weit entfernt. Er kennt seine Stärken, spielt sie voll aus und scheint damit zufrieden zu sein.
„Yeezus“ wie „Magna Carta Holy Grail“ sind großartige HipHop-Alben, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. Während „Yeezus“ ein reduziertes, faszinierendes, dunkles Geschoss voller Tiraden, Selbstbeweihräucherung und herrlichem Krawall ist, ist „Magna Carta Holy Grail“ einfach nur ein sehr gut produziertes, sehr gut gerapptes Rap-Monument. So ergänzen sich Ye und Hov mit ihren jeweiligen neuen Werken vortrefflich: Wo der eine Innovation um jeden Preis herbeizwingen will, bleibt der andere gelassen und vertraut dem Altbewährten. Wo der eine mit kalkulierten Radiosingles (vergleiche hierzu auch den nicht weiter erwähnenswerten Song mit Beyoncé) Profit schlagen will, gibt der andere offenbar keinerlei Fick mehr auf Charts und Radio. Wo der eine also die Tradition nicht nur verwaltet, sondern zu einer eigenen Kunstform erhebt, da schlägt der andere Schneisen in die Scheiße, dass die Schwarte kracht. Als richtungsweisend wird sich letztlich beides erweisen.


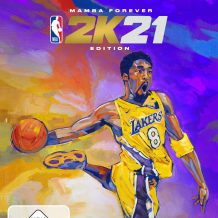



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






