„Ich mach keine Doubletime, weil ich es nicht kann und besser lassen sollte“ – mit dieser Line gestand Private Paul sich Anno 2009 etwas ein, was sich viele Rapper, gerade in Deutschland, wirklich zu Herzen nehmen sollten. Wer es nicht kann, sollte es lassen. Und mit „es können“ meine ich nicht Kollegah, der durchaus saubere Doubletime-Passagen rappen kann. Ich rede davon, die Tempovariation sinnvoll und wohlklingend in den Flow einzuweben, wie es etwa ein R.A. The Rugged Man, Tech N9ne oder Busta Rhymes tut. Ganz ohne vorhergehende Pause, die mit einem langgezogenen „Eyyyy“ gefüllt wird, um den unbeholfenen Bruch im Flow zu kaschieren. Solche Doubletime-Parts erfüllen nämlich nur einen Zweck: Muskeln zeigen.
Sie lassen den vorhergegangen Flow ins Nichts laufen, nur um kurz zu prahlen, und machen so den kompletten Verse unbrauchbar. Es geht um nichts, außer zu zeigen, wie schnell man rappen kann. Selbst Rapper, von denen ich sehr viel halte, haben in dieser Hinsicht schon mehrfach gesündigt: Etwa Tua, in dessen Frühwerk sich auch diverse Doubletime-Abfahrten finden, oder Amewu, dessen Standbein doch eigentlich die Inhalte sind. Ich glaube, diese Rapper lassen sich von ihrer schnellen Zunge korrumpieren, haben das Gefühl, wenn sie es schon können, müssen sie es auch umsetzen, sonst sei es Verschwendung. Bullshit! Ihr verschwendet gute Songs damit! Eure Doubletimes sind wie ein Witz, der einmal erzählt, und dann entwertet ist. „Wow, hör mal wie schnell“ – und fertig. Das klingt nicht gut. Das ist deutsche Streberkacke. Ich habe Eminems „Rapgod“ in meinem Leben vielleicht drei Mal gehört – weil es zwar kurzfristig beeindruckend, aber ansonsten einfach nur ein anstrengender Brei aus Konsonantenanschlägen ist.
Apropos Konsonanten. Ich erinnere mich an ein unglaublich peinliches Video von einer Kollegah-Autogrammstunde. Irgendein schrilles Blondchen rappt dem selbsternannten Boss stolz die Doubletime-Passage aus „Für immer“ vor. „Lade meinen Ballermann“ , ihr wisst schon. Abgesehen davon, dass die Performance ein Fremdscham-Trauerspiel der Extraklasse darstellt, obliegt die junge Dame auch noch einem weit verbreiteten Irrglauben. Die Kunst des schnellen Rappens liegt nicht darin, den Text möglichst hektisch und deutlich herunterzurattern – auch wenn das natürlich ein elementarer Bestandteil ist.
Die eigentliche Schwierigkeit aber liegt im Schreiben solcher Zeilen. Die Vokale und Konsonanten müssen perfekt aufeinander abgestimmt, getaktet und platziert, bestimmte Laute komplett vermieden werden – eben so, dass auch ein kleines Fangirl den Part mit ein bisschen Übung sauber nachrappen kann.
Beispielhaft dafür steht der legendäre „Dead in the middle of little Italy“ -Tonguetwister von Big Pun, in dem sich eben nicht das eigentlich phonetisch perfekt geeignete Wort „Literally“ findet. Warum? Das „eral“ darin lässt sich in dem Tempo einfach nicht gescheit aussprechen – und Pun konnte schreiben.
Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, für diese Abrechnung Nerdtalk zu vermeiden, aber damit wollte ich an dieser Stelle kurz aufräumen – Geschwafel über BpM und weitere Flowtechniken bzw. deren Schwierigkeitsgrade und Anforderungen erspare ich uns allen an dieser Stelle. Stattdessen appelliere ich noch einmal an die ganzen Larrys, die meinen, ein stabiler Doubletime-Part lege ihnen die Welt zu Füßen – Grüsse Gruss an Serc651 an dieser Stelle. Das kann alles noch so sauber sein, aber ihr verkackt damit den ganzen Track!
Doubletime- bzw. geflexte Passagen sollten dem Hörgenuss, der Flowvariation, dienen und nicht dem Schwanzvergleich. Der einzige Rapper hiesiger Gefilde, der das in meinen Augen handlen konnte, ist Hollywood Hank – der übrigens weder in Sachen Aussprache noch beim Timing Maßstäbe gesetzt hat. Wenn überhaupt, kriegt das noch Mike von den 257ers ganz anständig hin. Alle anderen sollten entweder ihre Prioritäten überdenken oder diesen speichelintensiven Schrott gleich an den Nagel hängen – man kann nämlich auch ohne diese krampfhafte Geschwindigkeitswahn-Scheiße beeindruckende Flows an den Tag legen.


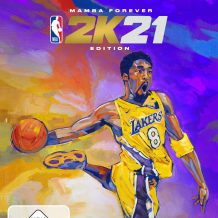



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






