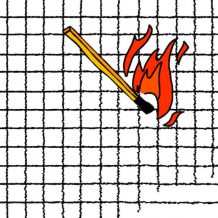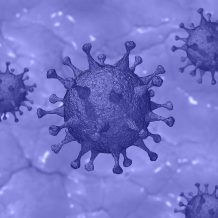Du trägst deine Jeans unter’m Hintern und dein T-Shirt ist so lang wie das Nachthemd deiner Mutter. Auf deinen Zähnen, um deinen Hals – überall schichtet sich das Gold. Dein rasierter Schädel wird durch eine Cap und ein darunter befestigtes Bandana um etwa zehn cm vergrößert. So schlenderst du in deinen 200 Euro teuren Sneakern durch deine Street und fühlst den textilen Swag. Tust du nicht? Wie jetzt? Aber du hörst doch Rap?
Auch wenn man im Jahr 2016 nur noch sehr selten die Assoziation hat, dass Rapfans nur Hänger in Baggys sind, tut sich genau zur selben Zeit ein anderes Problem für mich auf: Nämlich, dass manche Leute einfach irgendeine Erwartungshaltung dir gegenüber haben, wenn du Rap hörst. Und diese Erwartungshaltung bezieht sich häufig auf deine Klamotten:
„Du hörst wirklich Rap? Siehst gar nicht so danach aus…“ – Kopfschüttelnd und schon viel zu müde zum rechtfertigen holst du dir ein Bier im Späti, wo du einen musikalisch Gleichgesinnten triffst. Erleichtert denkst du, dass du in der Safezone bist, bis er ein Freestyle darüber startet, vor welchem Sneakerstore er zuletzt gecampt hat und wie teuer seine Bomberjacke war. Zu deiner Rechtfertigungsmüdigkeit aus dem vorhergehenden Gespräch kommt jetzt auch noch der absolute gesellschaftliche Kollaps hinzu und du stellst dir wie so oft diese eine Frage: Warum müssen wir über so etwas noch diskutieren? Wir befinden uns im 21. Jahrhundert: Es gibt immerhin Gender-Mainstreaming, Frauenquoten und sprechende Roboter – wieso zur Hölle streiten wir immer noch darüber, wie man auszusehen hat?
Kurze Rückblende: Wie so einiges kam die heute als Statussymbol genutzte, markenlastige Streetwear in den Anfängen gar nicht so edel daher wie heute. Der Weg dahin, dass du dich bedenkenlos mit rotem Bandana auf die Straße traust, war ein ziemlich langer. HipHop-Mode entsprang in sozialen Brennpunkten und war geprägt von einem Mangel an finanziellen Mitteln und einem Überschuss an echtem Thuglife. Gangster sein in Dieselbomberjacke für Promozwecke war zu dieser Zeit undenkbarer als ein erfolgreicher Kampf für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß. Man trug, was man bekam und was zum breakdancen geeignet war – also bequeme, weite Klamotten. Ziemlich weit weg von Cayler and Sons und New Era. Schon in den 70ern nutzen HipHop-Gangs verschiedene textile Statements und Accessoires um zu zeigen, welcher Gang sie angehörten und wie viele sie bereits abgestochen hatten (keine Props an euch dafür). In den 90ern wurde die Mode dann als eine Art Rebellion gegenüber der parallel aufsteigenden Discoszene benutzt – wer kein Bock auf sie hatte, trug eben HipHop. Und an alle die, die auf ihren markenbefüllten Pimpkleiderschrank schwören – es wird noch härter. Der Trend der tiefsitzenden Hose wurde alles andere als freiwillig im Knast geboren. Den Insassen wurden die Gürtel aus den Hosen gezogen, damit sie ihn nicht als Waffe nutzen konnten. Ihre Homeboys außerhalb des Knasts fühlten mit ihnen und trugen aus Solidarität ebenfalls die Hosen tief im Schritt.
Wieder in die Jetztzeit: So wuchs Rap über die Stadtränder hinaus und wurde zum Massenphänomen. Das haben nicht nur die reichen Familien verstanden, deren Söhne plötzlich „2Pac4Life“-Tattoos trugen, sondern auch die Kleidungsindustrie. Eine Flut von Designern überschwemmte plötzlich die Straßen. Sie versuchten das neue HipHop-Gefühl in textiler Form unter die Massen zu bringen – und das funktionierte, denn die Szene stand nicht mehr ausschließlich für das Leben auf der Straße und all ihre dreckigen Facetten. Rap war plötzlich für jeden da – für den Kleindealer an der Ecke, für den BWL-Studenten und seine Eltern. Und so wurde Rap, für mehr als den harten Kern, zum Lebensgefühl, das verkörpert werden will. Das stressige daran war und ist jedoch, dass das Verkörpern durch Mode zum Zwang und zum Anspruch wurde, ohne den es nicht mehr ging. Zwei Dinge, die die persönliche Individualität alles andere als untermauern- und da kommen wir zurück zum ursprünglichen Problem:
Wie muss man denn bitte aussehen, wenn man Rap hört? Auch wenn Shindy, Marteria mit seinen Marsiletten oder Kanye West uns das auf ihre Art vormachen, darf man nicht vergessen, dass Rap alles sein kann, aber vor allem eines ist: Für jeden etwas anderes und auf keinen Fall ein Dresscode. Heute weniger denn je. Rap ist eine der facettenreichsten Musikrichtungen, die es gibt und genau deswegen sollte auch das Publikum so abwechslungsreich und bunt bleiben, wie es ist. Ich persönlich genieße es durchaus auch, mich auf Konzerten umzuschauen und die unterschiedlichsten, aber doch einheitlich weißen Turnschuhe und Hoodies zu beobachten, in denen die pure Freude am Rap lebt. Aber noch besser fühlt es sich an, wenn ein Typ mit löchrigem Wollpulli und abgelatschten Sandalen in die Cypher steppt – und plötzlich die beste Line rappt, die ich je gehört habe.
Döll sagt auf einem seiner Tracks: „Es geht nicht drum‘, dass du (…) Supreme Kappen trägst oder weiße Nikes. HipHop hat kein Dresscode und verpflichtet nicht zu Airmaxx 99, ihr redet viel von Individualität aber gleicht euch Eins zu Eins.“ – Und das bringt auf den Punkt, was mal wieder auf den Punkt gebracht werden muss: Rap ist einfach mehr, als Jogginghosen und Superstars zu tragen. Kleider machen Leute? Nee. Leute machen Kleider. Und ziehen welche an. Punkt.