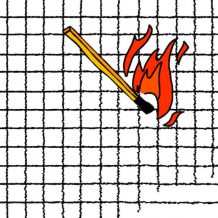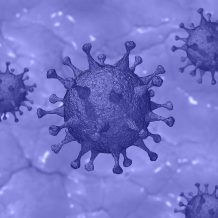Rechnet man die Gesamtspieldauer auf, habe ich vermutlich mit keiner Diskographie mehr Zeit verbracht als mit der von JAW. Und müsste ich mich auf nur einen deutschen Rapper festlegen, den ich fortan hören darf, würde ich mich vermutlich auch für JAW entscheiden. Nicht nur, weil jedes seiner Releases für mich ein Meisterwerk ist – auch, weil der Ehrendokta für jede Stimmung oder Lage passende Songs im Repertoire hat. Etwas Negatives schwingt zwar immer mit, aber häufig in gepflegter Battlerap-Manier, wo wohl nicht zuletzt Jottas RBA-Roots mit zusammenhängen.
JAW ist kein Allrounder in dem Sinne, dass er alles ganz anständig kann. Nein, alles ist brillant! Ob er auf dem biographischen Selftitled-Song eine zum Schneiden dicke Atmosphäre erzeugt und einen unkitschigen Seelenstriptease hinlegt oder die Welt fickt und ihr dabei ein „behindertes Kind“ macht, wobei er technische hochwertige Punchlines aus der Hüfte schießt und ohne jegliche Anstrengung den Beat in Grund und Boden flowt – die charakteristische Härte bleibt nie aus. JAWs Stimme hat zudem einen unglaublichen Wiedererkennungswert, ohne dabei unangenehm oder nicht raptauglich zu sein.
Auf Feature-Parts oder gar Kollabo-Releases stand Jotta nie im Schatten seiner Mitstreiter. Die Kollabo-EP „Menschenfeind“ mit Hollywood Hank brachte zwei der größten Koryphäen aus dieser musikalischen Ecke zusammen. Und der Titel war Programm: Jaw und Hank hassten um die Wette, ein Part besser und ekelhafter als der vorhergegangene, ein Song hasserfüllter als der andere. Das Album mit der damaligen Crew PCP bestehend aus Private Paul, Rynerrr, Maexer Cash und DJ Tjoma, steht dem um nichts nach. Ein musikgewordener Film, ein postapokalyptisches Szenario, das düsterer und schonungsloser kaum sein konnte. Vier von der Gesellschaft geächtete, die nun ohne geltende Strukturen vom Recht des Stärkeren Gebrauch machen, aber eben auch alles verloren haben. Private Pauls packende Bildsprache, Rynerrrs brutal kantige Poesie und Maexers greifbare Metaphern ergänzen sich perfekt mit JAWs Händchen für Atmosphäre und Szenarien. Ein Album wie dieses gab es im deutschen Rap kein zweites Mal – leider. Das Crew-Debüt „Nimm’s und verreck daran“ ist hingegen weniger der Rede wert, hat aber auch drei Jahre mehr auf dem Buckel.
Entgegen der Regel wurde Dokta Jotta auch als Solokünstler mit der Zeit immer besser, statt nachzulassen: Sein letztes Album „Täter-Opfer-Ausgleich“, das leider über sechs Jahre zurückliegt, ist nicht nur seine persönliche Bestleistung, sondern eines der besten Deutschrap-Alben überhaupt. Eine unglaubliche Spannungskurve durchzieht den Langspieler, die beiden „TOA“-Songs gehören zum Intensivsten und Haarsträubendsten, was ich jemals gehört habe. JAW schildert in unglaublich cineastischem Storytelling, wie er seine Peiniger aus der Schulzeit viele Jahre später heimsucht und abstraft. Selten ging Musik dermaßen unter die Haut.
Auch Songs wie „Meine Fans“, eines seiner wenigen Werke, das mit einem Video ausgestattet wurde, sind legendär. JAW charakterisiert seine Fans, die – wie sollte es anders sein? – reichlich absonderliche Gestalten sind. Ob das jetzt auf jeden zutrifft, sei mal dahingestellt. So unterschiedlich all diese Songs und Releases auf dem Papier klingen mögen: JAWs eigene Handschrift ist unverkenntbar. Auch als Produzent. Im Produzentensessel fühlt der Freiburger sich nämlich auch ziemlich wohl. Für „Täter-Opfer-Ausgleich“ produzierte er fast die Hälfte der Songs, aber auch zu Kollegahs „Alphagene“ steuerte er eine Handvoll Beats bei.
Ein Typ, der alles kann, alles gut macht – aber leider Gottes in der Versenkung verschwunden ist. Seitdem es mit dem Juice-Exclusive „Rap hat dich kaputt gemacht“ und den Freetracks „Weltenpendler“ und „Lost in Space“, die beide merkwürdig wirr und spirituell anmuteten, ein letztes Lebenszeichen gab, hörte man seither nichts mehr vom angekündigten Album „Unerträgliche Dreistigkeit des Seins“. Als Besucher des Innen Drinnen Festivals 2014 konnte man noch in den Genuss eines unveröffentlichten Songs kommen, in dem JAW auf unglaublich emotionale Art den Tod seiner Mutter verarbeitet. Und im Februar 2015 erschien sein Song „Survival of the Sickest“. Das war’s dann aber auch bisher. Und das bedauere ich zutiefst.