Früher war die Sache klar: Berichterstattung über HipHop war Fansache. Enthusiasten und hoffnungslose Idealisten gründeten Fanzines, die Juice, Backspin oder Mkzwo hießen und schrieben voller Begeisterung Artikel über alles, was sie gerne hörten. Es ging um Rap, aber auch um Graffiti, Beatboxing, DJing, B-Boying – alles, was dazu gehört halt. Nicht immer in perfektem Deutsch formuliert, aber stets von einem großen Interesse an der Sache geprägt. Heute hingegen stellt sich das Ganze etwas anders dar. Auf der einen Seite ist die Professionalität gestiegen, gibt es mehr als nur ein oder zwei etablierte HipHop-Medien, die sich auch nicht mehr unbedingt nur als Fanzines begreifen. Auf der anderen Seite muss man allerdings froh sein, dass es noch kein Medium geschafft hat, irgendeinen angeblichen Bezug zwischen Deutschrap und der Geburt dieser britischen Prinzessin herzustellen.
Denn obwohl auf der einen Seite die Professionalität und die Auswahl gestiegen sind, es qualitativ hochwertige Formate in Schrift- und Videoform gibt, hat auch ein Phänomen Einzug gehalten, dass man mit der HipHop Bravo eigentlich für erledigt geglaubt hatte: Berichterstattung über HipHop ohne HipHop. Da werden Lil Wayne oder Kanye West als „US-Rapstars“ bezeichnet, da wird zu jedem dämlichen Massenevent versucht, krampfhaft ein Bezug herzustellen („Deutschrap über das große Wetten-dass-Special mit Thomas Gottschalk„), da wird ahnungs- und vor allem lieblos über jede Menge Schrott berichtet, die mit HipHop oder Rap nur am Rande zu tun hat, aber Klicks verspricht.
Klar, beides ist ein logischer Prozess: Auf der einen Seite steigt mit der Zeit die Professionalität, auf der anderen Seite nimmt die Zahl der Trittbrettfahrer zu. Beides hat dieselbe Ursache: Rap ist in Deutschland immer erfolgreicher, immer präsenter in der Alltagskultur. Wenn man „Ich trage Mantel“ sagt, versteht einen nicht nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten, sondern auch die Jungs und Mädels aus der Spielo, aus dem Hörsaal oder dem Großraumbüro. Es ist völlig klar, dass die Massenwirksamkeit von HipHop einerseits zu einer Steigerung des Qualitätslevels der Berichterstattung geführt hat (für alle Nörgler: Visa Vie, Staiger, Falk, Toxik trifft, Insider, Jan Wehns Kolumnen auf allgood.de usw.), andererseits jede Menge Geier angelockt hat, die gerne ein paar schnelle Euros mit der Kultur verdienen wollen, die sie nicht wirklich interessiert, für die sie keinen Respekt und schon gar keine Liebe haben.
Die Frage ist: Schadet das HipHop? Schadet es der Kunstform und der Kultur? Macht es aus Kunst reinen Kommerz und vor allem: Erzieht es eine neue Generation von Rapfans, die sich weder für die Grundlage und -werte von HipHop noch für die Kultur an sich interessieren, sondern ausschließlich für Gossip, Geplapper, flüchtige Sensatiönchen, den berühmten Sturm im Wasserglas eben. Das wäre dann tatsächlich Scheiße. Denn auch wenn ich kein Bruder im Geiste von Torch bin oder war, nie gebreakt habe, nie ernstzunehmend gesprüht, gerappt auch nicht und auch als DJ nicht mehr als den Fader von links nach rechts schieben kann, hat mich an Rap immer mehr fasziniert als nur die (zugegebenermaßen großartigen) Stories drumherum. Nenn‘ es Feeling, nenn‘ es Aura, nenn es, wie du willst. Aber nenn‘ es nicht Boulevard – es sei denn, wir reden vom Crenshaw Boulevard in Los Angeles.
Natürlich ist Rap schon immer eine schillernde Kultur gewesen, um die herum sich viele interessante, spannende Geschichten erzählen lassen. Geilere Geschichten, als um Pop oder Techno. Zumal Rap eine sehr textlastige Musikrichtung ist und das Narrative, das Erzählen von Geschichten damit schon in sich trägt. Solange diese Geschichten noch irgendeinen Bezug zum Kern, also zu Rap, haben, ist das ja auch komplett in Ordnung. Alles gut. Leider franst das Ganze an den Rändern aber immer mehr aus, wird das Privatleben von Rappern immer wichtiger, auch wenn es mit der Musik überhaupt nichts zu tun hat. Sicher ist das ein gesellschaftlicher Trend, der auch außerhalb von Rap spürbar ist. Von immer mehr Promis weiß niemand mehr, was sie eigentlich genau tun. Vermutlich deshalb, weil sie gar nichts tun. Sie sind durch irgendeinen – für sie glücklichen – Zufall berühmt geworden. Reicht.
Es gibt keinen Grund, alles schwarz zu malen. Es gibt nach wie vor Berichterstattung über HipHop, die auf der Grundlage von Sachkenntnis einerseits und Liebe für die Sache andererseits (oft ein schmaler Grad) passiert. Klar fällt das Reißerische, das Plakative, das Marktschreierische schneller ins Auge und verdeckt manchmal das Kritische, das Nachhakende, das wirklich an der Sache Interessierte. Oftmals verwischen die Grenzen inzwischen auch. Plattformen, die an sich für eine sachliche, kenntnisreiche Herangehensweise bekannt sind, lassen sich von schnellen Klicks und rasch wachsender Reichweite locken. Auch rap.de war von dieser Krankheit schon befallen, wie ich bereits in meinem Kommentar zum 1. April selbstkritisch angemerkt habe.
Der Kurs, den wir nicht erst seitdem, sondern auch schon die Wochen davor eingeschlagen haben, der rapferne Themen ausklammert und sich auf die Essenz der Kultur zu besinnen versucht, mit einer ordentlichen Portion Kritik – dieser Kurs und die Tatsache, wie gut, ja, teilweise begeistert er angenommen wird, zeigt mir, dass es sehr wohl noch Platz für eine ernstzunehmende und ernstgemeinte Berichterstattung über HipHop aus HipHop-Sicht. Kümmern wir uns also nicht zu viel um die falschen Propheten und Rattenfänger, sondern konzentrieren wir uns lieber auf das, was wirklich zählt: Auf Rap.


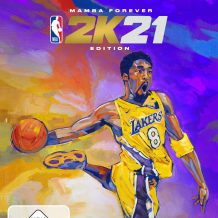



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






