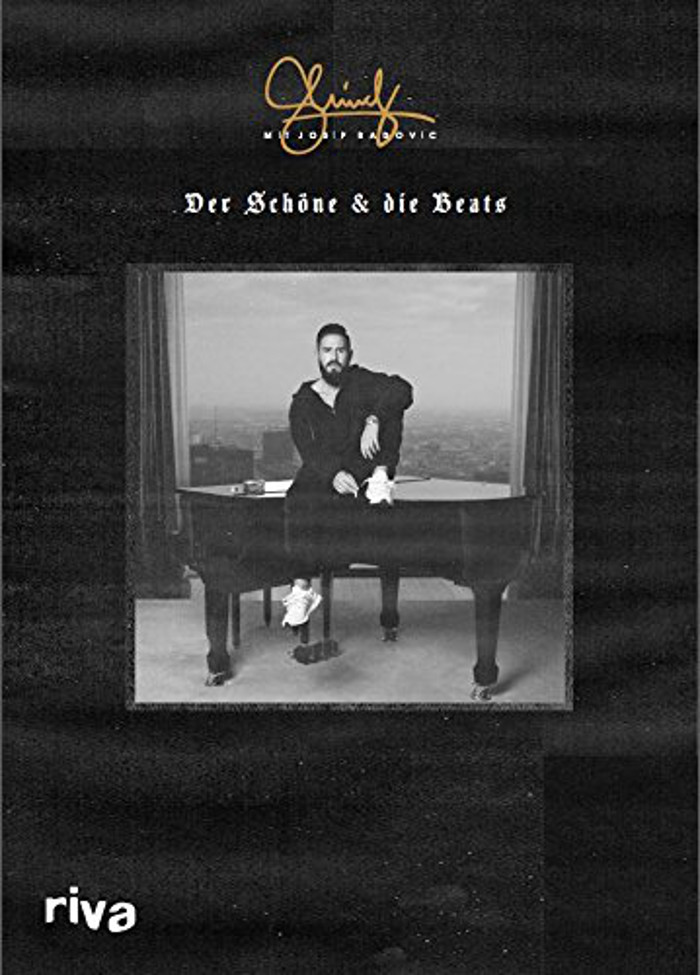„Wenn ich eine Sache auch nur halbwegs gut kann, dann ist es, Menschen zur Weißglut zu treiben“, schreibt Shindy in seiner Biographie „Der Schöne und die Beats“. Vermutlich war es nicht das erklärte Hauptziel des Ersguterjunge-Rappers, der Leserschaft auf die Nerven zu gehen: Das Lesen dieses 240-seitigen Eigenlobes hat mich jedoch tatsächlich zur Weißglut gebracht.
Die am 9. Mai erschienene Autobiographie „Der Schöne und die Beats“ ist das Resultat eines Angebots, das Shindy vom Riva-Verlag erhielt. Laut Josip Radovic, der ein Redakteur des Lifestyle-Magazins für Männer Gentlemen’s Quarterly (GQ) und Mitautor des Buches ist, folgt die Publikation der Biographie einem „Businessplan“, der in erster Linie Shindys kommenden Alben dienen soll. Der Rapper bezeichnet das Buch, das innerhalb von fünf Monaten fertigstellt wurde, als „Motivations- und Märchenbuch“. Soweit die Selbsteinschätzungen.
Im Laufe des Buches werden die Lesenden nicht nur mit dem Menschen Michael Schindler, so der bürgerliche Name des Künstlers, vertraut, sondern auch mit dem Werdegang des Rappers Shindy. Mehr als die Hälfte des Buches widmet Michael Schindler seinem ersten Lebensabschnitt – Geburt bis zum Abbruch seines BWL-Studiums nach dem ersten Semester. Seine Kindheit, die er in einem wohlbehüteten Haushalt der Mittelschicht in der schwäbischen Kleinstadt Bietigheim-Bissingen verbringt, läuft ohne nennenswerte Tief- oder Höhepunkte ab. Aus diesem Grund gewinnt der Lesende schon nach den ersten Seiten den Eindruck, dass dieses Buch vor allem eins ist: belanglos.
Josip Radovics Leistung ist durchwachsen. Auf den ersten Blick wirkt es tatsächlich so, als ob Radovic es geschafft hätte, so zu schreiben, wie Shindy spricht. Der GQ-Journalist verwendet zum Beispiel Shindy-typische Begriffe: „therapieren“ für jemanden nerven beziehungsweise überreden oder „original“ als Synonym für total oder voll. Auf den zweiten Blick fallen einem jedoch einige Ungereimtheiten in Radovics Schreibstil auf: Durchgehend im Buch wird beispielsweise „Dicka“ verwendet. Zu Beginn der 2000er – Shindys Jugend also – hat aber so gut wie niemand in Süddeutschland dieses Berliner Pendant zum Hamburgischen „Digga“ verwendet. Diese fehlende Liebe zum Detail vermittelt leider den Eindruck, dass dieses Buch lieblos geschrieben ist. Hinzu kommt, dass Radovics Art und Weise, Sätze zu bauen, größtenteils monoton bleibt – „Ich hatte […]. Ich konnte […].“ –, was den recht redundanten Inhalt noch qualvoller zu lesen macht.
Die Oberflächlichkeit der Autobiographie fällt aber vor allem in der inhaltlichen Herangehensweise auf. „Der Schöne und die Beats“ ist ein Buch, das einfach nur erzählt. Seine Mitmenschen analysiert Shindy nur selten, sein eigenes Handeln reflektiert er noch seltener und sich selbst kritisiert er gar nicht. Gerade diese Tiefgänge – und eingestandenen Fehler – würden eine Biographie aber lesenswert machen. Radovic gelingt es nicht, diese Tiefe in der Shindy-Biographie zu schaffen. „Der Schöne und die Beats“ gleicht deshalb einem gelangweilten 16er, der gerade so den Takt trifft, ansonsten aber wenig beim Hörer hinterlässt.
Ehrgeizig war Michael Schindler schon als Zehnjähriger: montags und donnerstags Fußballtraining, dienstags Gitarrenunterricht, mittwochs Schwimmen und freitags Kunstkurs; am Wochenende kickte er mit seiner Mannschaft gegen Gleichaltrige. Mit dreizehn Jahren fing er an Zeitungen zu verteilen, um finanziell unabhängiger von seinen Eltern zu sein. Das klingt in Shindys Worten so: „Ich brauchte Geld. Ich brauchte Klamotten. Ich brauchte die weißen Nike Air Force.“ Noch als Schüler stand Shindy bei McDonald’s an der Kasse. Danach setzte er bei der Firma Rittenberger & Söhne am Fließband Autoteile zusammen. Man sieht: Seine Zielstrebigkeit ist ein Grund, warum er mittlerweile so erfolgreich ist. Das lobt auch Arafat Abou-Chaker im Nachwort des Buches.
Man erfährt immerhin, dass Schindler kein Hurra-Patriot, sondern pazifistisch eingestellt ist. Das wird der Leserschaft klar, wenn er – als Deutsch-Grieche mit doppelter Staatsbürgerschaft – vor der Wahl steht, für welches Land er zum Bund will: „Dieser ganze Militärquatsch hat für mich sowieso nichts mit Patriotismus zu tun. Ich glaube nicht, dass es Griechenland besser geht, wenn ich im Schlamm rumrobbe und den ganzen Tag angeschrien werde.“
Als Rap-Fan liest man Shindys Biographie natürlich mit der Erwartung, mehr über den EGJ-Künster zu erfahren. Diesbezüglich ist „Der Schöne und die Beats“ enttäuschend, da man vergleichsweise wenig über den Rapper Shindy erfährt: Er hat zum Beispiel mit dreizehn Jahren schon ein Album aufgenommen. Den arroganten Rapstil hat er sich von den US-Rappern Fabolous, Mase und Loon abgeschaut. Shindy erklärt auch, dass er nicht „auf diesem Übung-macht-den-Meister-Film“ ist und davon überzeugt ist, „dass Kreativität ein begrenztes Gut ist.“ Das ist ein sehr interessantes Verständnis vom künstlerischen Schaffensprozess, das durchaus Bestand haben kann. Leider hielten es weder Radovic noch Schindler für nötig, diesen Gedanken weiter auszuführen. Schade.
Das wiederholt sich im Laufe des Buchs: Michael Schindler brüstet sich zwar damit schon als kleiner Junge in der Kunstschule verstanden zu haben, was Ästhetik ist, aber wagt in den 240 Seiten nicht ein Mal den Versuch, sein Verständnis von Ästhetik der Leserschaft verständlich zu machen. Deshalb bleibt sein Anspruch an sich selbst, „Deutschrap ästhetisch zu machen“, seltsam ungreifbar.
Auch wenn „Der Schöne und die Beats“ kein selbstreflektierendes Buch ist, sagt es doch einiges über Michael Schindler aus. Er liebte seine Oma, weil sie zum einen immer hinter seiner Musik stand und zum anderen, weil sie ihm immer sagte, dass ihr Enkel „der schönste Mensch der Welt“ sei. Auch nachdem Shindy seinen Plattenvertrag bei Ersguterjunge unterschrieb, wohnte er zu Hause und ließ sich von „Mama“ Frühstück machen. Bequem, wie er ist, „mogelt[…]“ Shindy „[s]ich […] extrem erfolgreich durch“ seine Jobs. Beim Zeitungsaustragen verbrachte er die meiste Zeit damit, die Zeitungen in verschiedene Mülleimer der Stadt wegzuschmeißen. In seinem Zivildienst hatte Shindy einen Arzt gefunden, der ihm Krankenbescheinigungen auf Wunsch ausstellte. Wenn er auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, spielte er das Unschuldslamm und ließ sich Ausreden einfallen – Verantwortung für seine Fehler übernimmt er offenbar nicht, ganz zu schweigen von einem Bewusstsein, wozu sein Handeln führen könnte. Man fragt sich, ob Shindy wirklich nie ein schlechtes Gewissen hinsichtlich seiner Betrügereien hatte.
„Der Schöne und die Beats“ glorifiziert Luxusmarken wie Louis Vitton oder Gucci. Diese kritiklose Konsumgeilheit steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Bambi-Verleihung 2011, bei der Bushido den Integrationspreis bekam. Dort zeigt sich Shindy von der Oberflächlichkeit der C-Prominenten selbst angeekelt. Gleichzeitig ist die Glorifizierung der Lebensziele dieser Promis – Ruhm und viel Geld – ein Kernthema in seinen Raps (zum Beispiel in seinem Song „Rentner“, in dem er finanziellen Reichtum als höchstes Lebensziel darstellt). Shindy offenbart hier einen Widerspruch: Warum glorifiziert er in seiner Musik solch ein Leben, wenn es ihn eigentlich anekelt? Die Auslotung seiner Haltung wäre sicher interessant, aber sie findet leider nicht statt.
Shindy ist davon überzeugt, dass man, um reich zu werden, „eine gute Idee, ein wenig Glück und [BWL und VWL] Grundlagen“ braucht. Nachdem sein Debütalbum „Nie wieder arbeiten“ (NWA), das 2013 erschien, direkt auf Platz Eins der deutschen Albumcharts eingestiegen ist, erklärt er, dass die größte Motivation für sein zweites Album „FVCKB!TCHE$GETMONE¥“ (FBGM), das 2014 erschien, eine rein finanzielle war: „Jetzt musste das nächste Album kommen und Goldstatus erreichen. Das hatte ich mir in den Kopf gesetzt, aber ich traute mich nie, es irgendjemandem zu sagen.“ Damit rückt sich Shindy selbst in ein Licht, das ihn weniger als aufrichtigen Künstler zeigt, sondern eher als Consulting-Rapper (Consulting-Unternehmen beraten Firmen, überarbeiten sich chronisch und haben vor allem eins im Kopf: Geld scheffeln.)
Nach 27 Jahren haben die meisten Menschen eine Liebesgeschichte erlebt, die sie geprägt hat. Wenn man „Der Schöne und die Beats“ zu Ende gelesen hat, fällt auf, dass Shindy sich zu diesem Thema einfach gar nicht äußert. Entweder führt Michael Schindler ein asexuelles Leben, schämt sich für seine Liebesbeziehungen, oder er hat bewusst diesen Aspekt seines Lebens ausgelassen. Wenn letzteres der Fall ist, dann unterstreicht das ein Mal mehr die Oberflächlichkeit dieses Buchs.
Es ist aber nicht so, dass Shindys Biographie keine Rückschlüsse auf sein Verständnis von Frauen und Männern ziehen lässt. An einer Stelle erklärt er, dass er seine Lehrerinnen nie als Autoritätspersonen wahrnehmen konnte: Um Shindy Respekt einzuflößen, brauchte es einen Mann mittleren Alters, der ihn anbrüllte. Hm. An einer anderen Stelle spricht er von der „Fotzenhaftigkeit“ seiner Chemielehrerin. Die Zurechtweisungen seines Chefs bei McDonald’s konnte er auch nie ernst nehmen, da „er mit seiner schwuchteligen Stimme, die, auch wenn er wirklich wütend war, noch immer freundlich klang“. Die zwei Mitarbeiterinnen bei McDonald’s, mit denen Michael Schindler nicht klar kam, bezeichnet er mehrmals als „Kampflesben“.
Die konkrete Beschreibung seines Lebens ermöglicht also einige Rückschlüsse auf den Menschen Michael Schindler (weniger auf den Künstler Shindy): Auf der einen Seite ist er bequem, aber zielstrebig. Ästhetik ist ihm im Aussehen und in der Musik wichtig, jedoch erklärt er nicht, was dieser Begriff für ihn bedeutet. Auf der anderen Seite ist er ein Muttersöhnchen, der in beruflichen Verhältnissen durch Dreistigkeit und Unaufrichtigkeit auffällt; er trägt einen latenten Seximus mit sich herum und er hat – ganz im Einklang mit der Philosophie eines erfolgreichen Consulting-Unternehmens (zum Beispiel Ernst & Young) – ein großes Ziel: Geld, Geld, Geld. Seine ziemlich lieblos geschriebene Biographie ist dementsprechend vermutlich hauptsächlich Promo für seine kommenden musikalischen Projekte. Es ist kein Werk, das für sich steht. Verkaufen wird es sich trotzdem sehr gut. Oder um es anderes zu sagen: ein Geniestreich eines Consulting-Rappers.